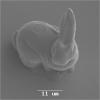Informationen aus Astronomie, Biologie, Chemie, Geologie und Physik
Ein Experiment am Berliner Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie misst magnetische Kräfte von ultastarken Laserpulsen. Diese Studie wurde kürzlich vom "Journal of Physics B" ausgezeichnet. Die Ergebnisse sind auch für künftige Laser-Teilchenbeschleuniger interessant...
Mainzer Physiker tragen zur Messung von Teilchen-Antiteilchen-Oszillationen am Fermilab in Chicago bei
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz haben bei Experimenten am US-Teilchenbeschleuniger Fermilab einen entscheidenden Beitrag zur Messung der Eigenschaften von Bs-Mesonen, subatomaren Teilchen, die aus einem Quark und einem Antiquark aufgebaut sind, geliefert. "Diese Messung wir...

Gemeinsam mit Wissenschaftlern des Forschungszentrums caesar stellen Zoologen der Universität Bonn auf der Hannover Messe vom 24. bis 28. April einen neuartigen Infrarotsensor vor. Das bisher in Natur und Technik unbekannte Messprinzip haben sie dabei einem kleinen Insekt abgeschaut: dem Schwarzen ...
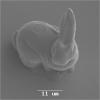
Die Nanotechnologie wird immer bedeutenderer und marktfähiger und bietet jetzt schon ein großes Potential für Innovationen. Es fehlen jedoch oft geeignete Werkzeuge für diese Technologie, insbesondere industrietaugliche Maschinen, um dreidimensionale Strukturen mit Auflösungen unter einem Mikro...
Mit dem Ziel, Implantate dem menschlichen Körper besser anzupassen, führt das Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) aktuell Forschungsaktivitäten durch. Durch die Auf- bzw. Einbringung lasergenerierter Nanopartikel können Implantate oder medizinische Geräte mit besonderen Funktionen versehen oder d...

Bestimmte Signalfaktoren bei Nervenzellen erfüllen gleich zwei Aufgaben: Wachstum und Orientierung
Gehen und Sprechen sind für uns meist selbstverständlich. Doch was wir unbewusst erledigen, verlangt von unserem Körper eine große motorische Leistung: Wie die Musiker in einem Orchester spielen dabei viele Muskeln zusammen. Nerven steuern die zahlreichen Muskelgruppen, die daran beteiligt sind....

MPI-Wissenschaftler haben ein neues Gesetz entdeckt, wonach sich die Auflösung in der Fluoreszenzmikroskopie auf wenige Nanomet
Das von Ernst Abbe 1873 formulierte Gesetz zur beugungsbegrenzten Auflösung im Lichtmikroskop haben jetzt Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen überwunden und ein neues Gesetz, das in der Fluoreszenzmikroskopie eine unbegrenzte optische Auflösung erm�...

Göttinger Max-Planck-Forschern gelingt erstmals Nanostrukturen der biologischen Signalübertragung sichtbar zu machen
Ein neues Fenster in die biologische Nanowelt haben Forscher des Göttinger Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie aufgestoßen: Mit Hilfe der am selben Institut neu entwickelten STED-Mikroskopie (Stimulated Emission Depletion) konnten die Forscher jetzt erstmals Proteine in einzelnen syn...

Kamera des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung liefert erste Bilder vom Südpol der Venus
Das am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung entwickelte Kamerasystem "Venus Monitoring Camera" (VMC) an Bord der europäischen Raumsonde Venus Express hat zwei Tage nach Einschwenken in eine Umlaufbahn erste Bilder unseres Schwesterplaneten Venus zur Erde gesendet. Aufgenommen aus etwa 200...

Ultrakurze Laserpulse im Femtosekunden-Bereich haben sich als effektive Werkzeuge bewährt, um photochemische Reaktionen kontrolliert zu steuern: Unter dem Einfluss des Lichtpulses ändern die Elektronen ihre Quantenzustände, was das Aufbrechen einer chemischen Bindung oder auch ihre Neubildung zur...